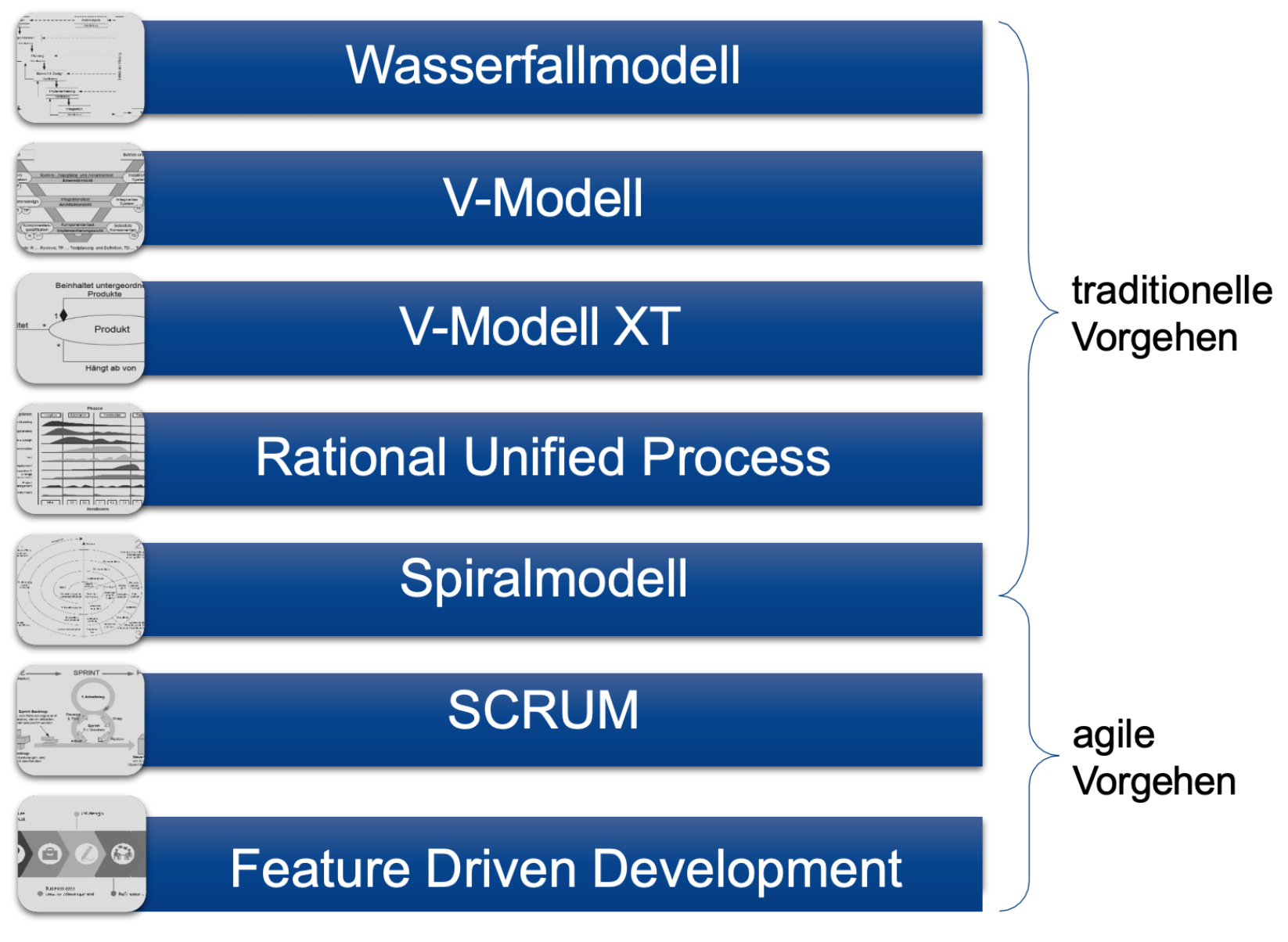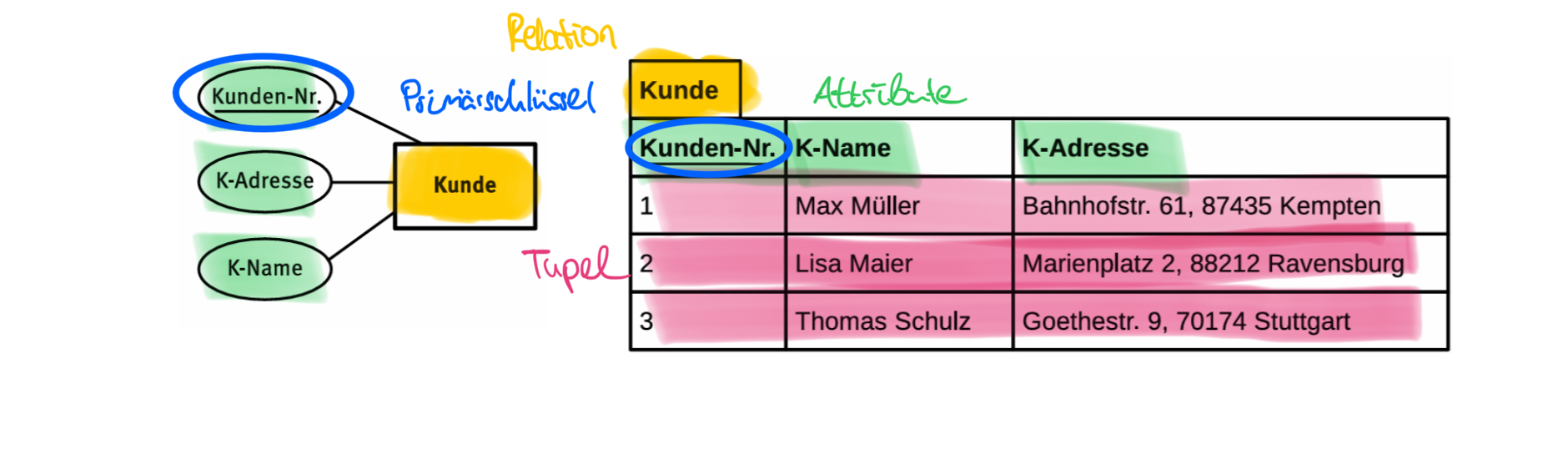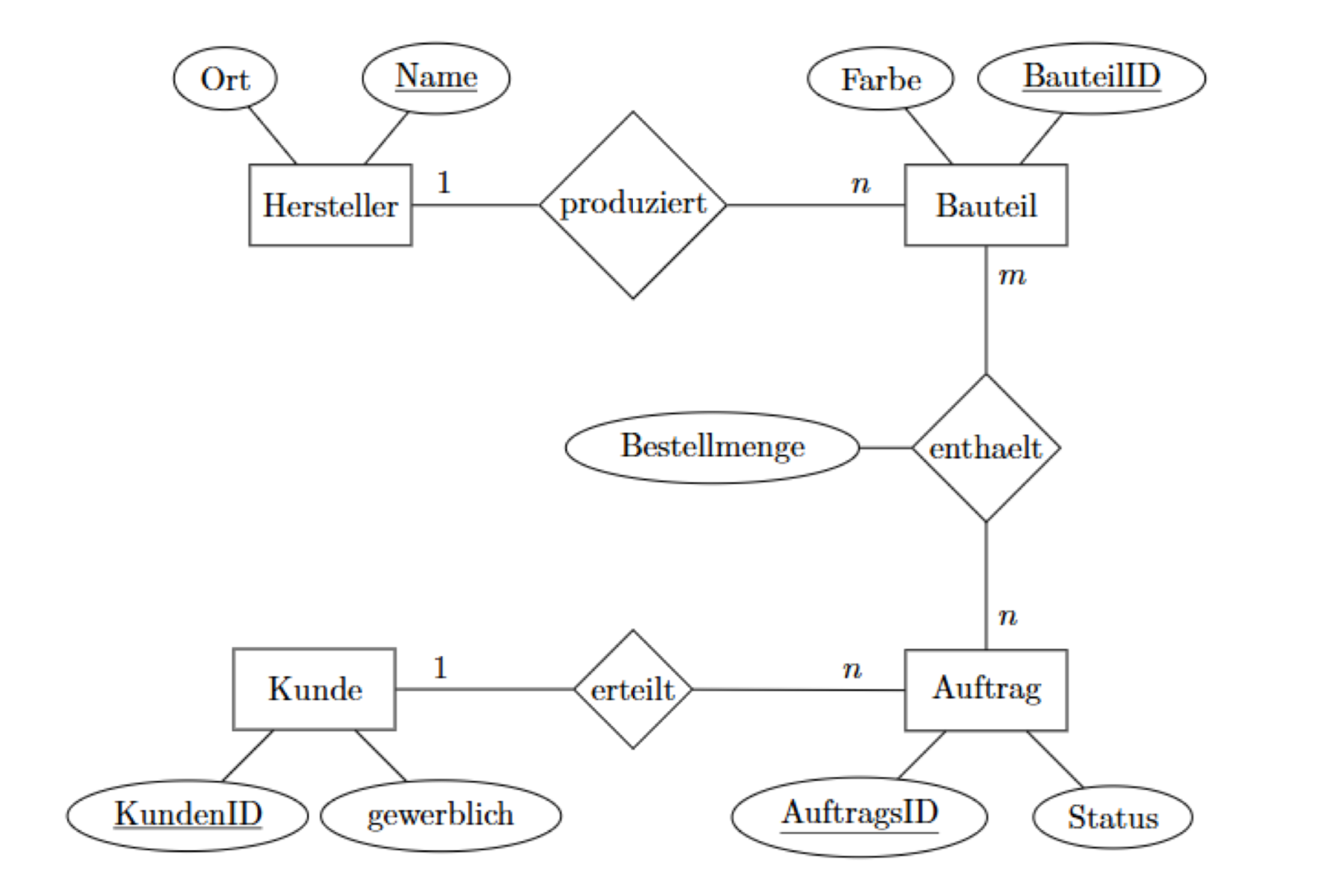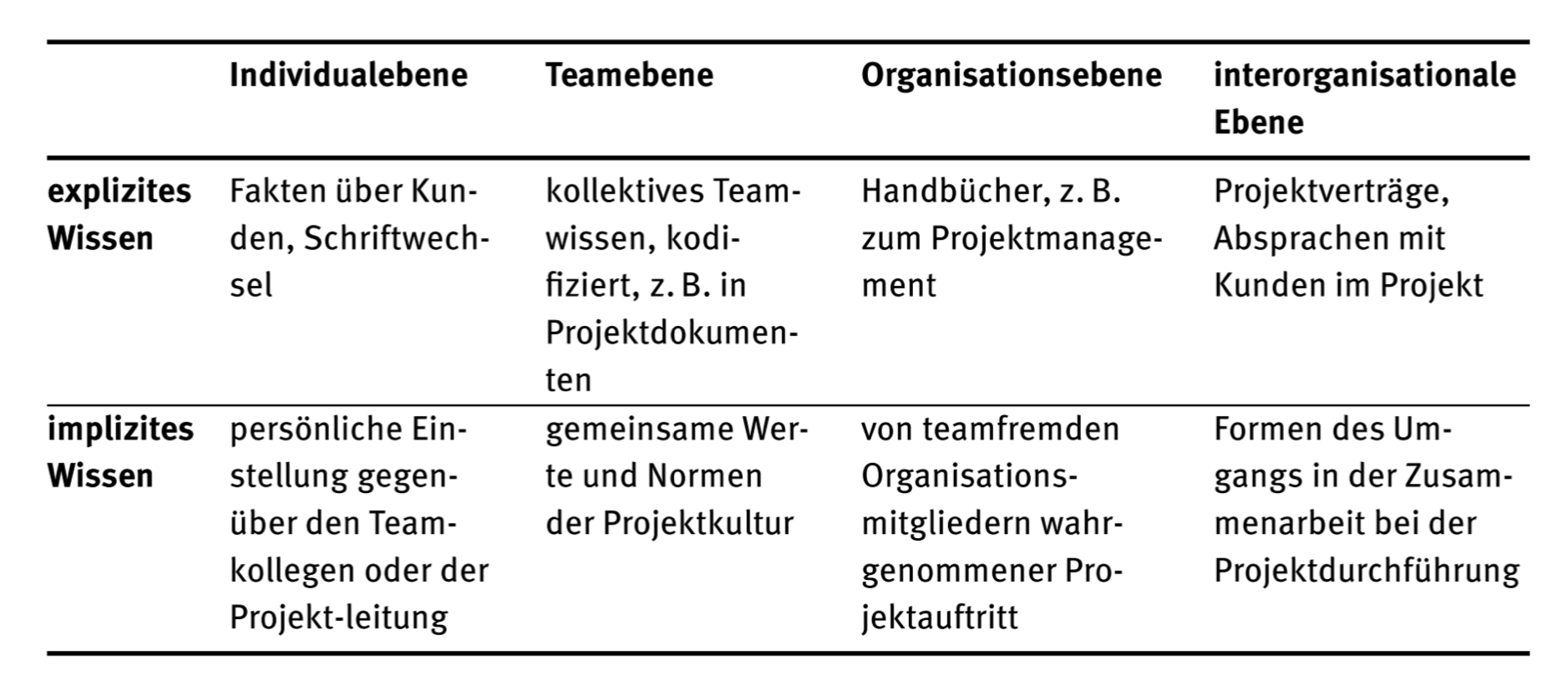Grundlegende Begriffe
Wirtschaftsinformatik
→ Information Systems
Definition
Die Wirtschaftsinformatik ist ein Teil der Wirtschaftswissenschaften und beschäftigt sich mit
- Anwendung der Informatik in Wirtschaftswissenschaften
- strategischer Planung, Aufbau & Beobachtung von Informationssystemen
→ Zentraler Gegenstand sind die Informationssysteme
zweite Definitionsgrundlage: Lebenszyklus der Informationssysteme
Information & Wissen
hierarchisch
differenziert
- Information → Bewegungsgröße
- Wissen → Bestandsgröße Information ist zusätzliches zweckorientiertes Wissen Daten sind Ausgangspunkt für Informationen
System & Modell
Informations- und Anwendungssystem
Definition Informationssystem
künstliches, konkretes System
besteht aus maschinellen und menschlichen Elementen
versorgt Nutzer mit Informationen
Modell & Element einer/mehrerer Organisation(en)
Wird meistens von Menschen entwickelt
beinhaltet
- den Menschen als Anwender
- Anwendungssystem (AS), welches aus der Anwendungssoftware sowie der „darunter“ liegenden Basissoftware und dem Hardwaresystem besteht
Intention der Softwareentwickler: dass sich das IS wie von ihnen geplant verhält.
ZENTRAL Informationssysteme sind soziotechnische Systeme im Sinne der Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft
Nachbardisziplinen
- ==Informationssysteme sind soziotechnische Systeme im Sinne der Wirtschaftsinformatik==
- Wirtschaftsinformatik ist eine „hybride“ Wissenschaftsdisziplin und nimmt relevante Lösungsansätze aus benachbarten Disziplinen
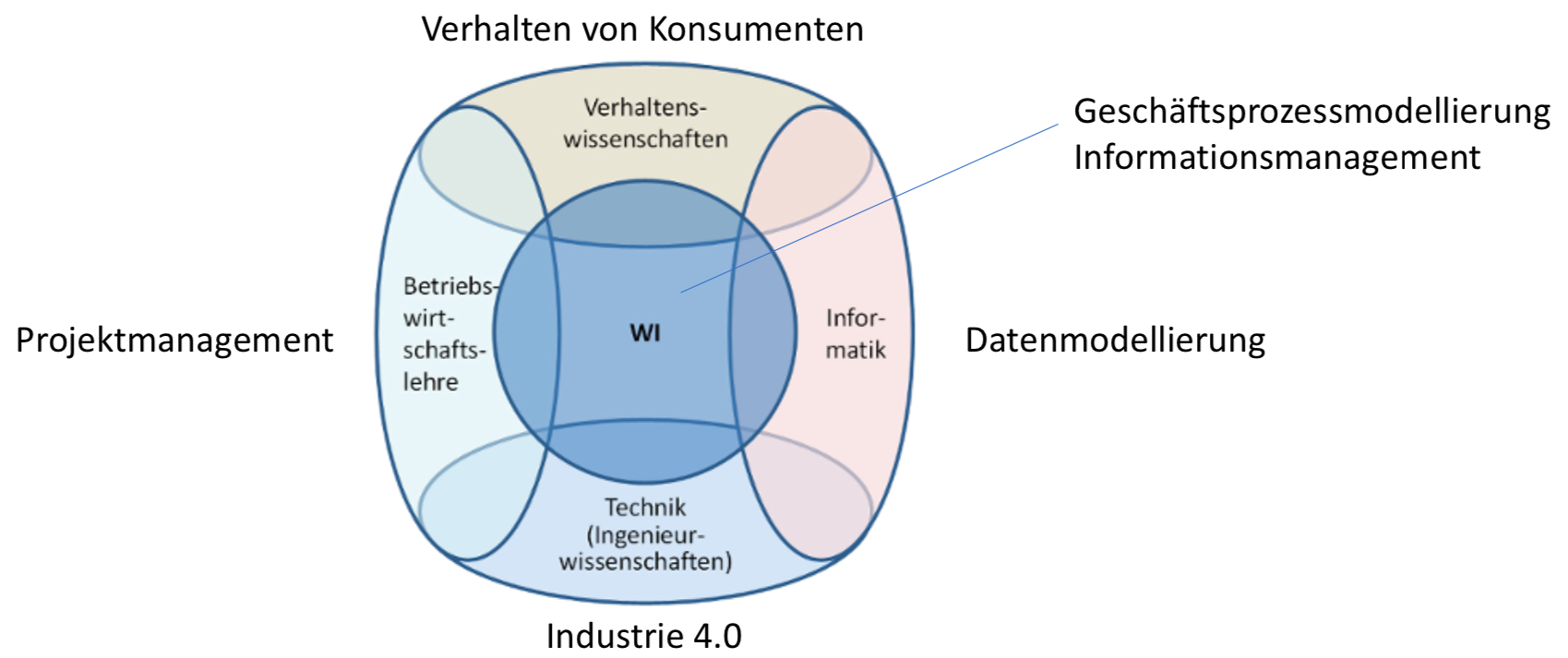
Gegenstand der Wirtschaftsinformatik
Komponenten eines Informationssystems
- Mensch
- als Gestalter und Anwender im Mittelpunkt der WI
- Aufgabe
- konkrete Aufgabenunterstützung in operativen & strategischen Geschäftsbereichen
- Technik (IT)
- alle Funktionen, mit denen Informationen betrachtet und manipuliert werden können
- Organisatorischer Kontext
- betriebliche Informationssysteme sind Bestandteil einer komplexen organisatorischen Umwelt, in die sie passen müssen
Informationssysteme als soziotechnische Systeme
IS als soziotechnische Systeme
- auch bei Fokus auf Kommunikationsaspekt: es findet immer Austausch von Informationen statt
==Informationssysteme sind soziotechnische Systeme im Sinne der Wirtschaftsinformatik==
Soziotechnisches System
- Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen sozialen und technischen Systemen (Mensch-Maschine) → soziale & technische Systeme werden Teilsystem des soziotechnischen Systems
Untersuchungsaspekte:
- Integration Technik/Tecchnologie in gesellschaftliche Subsysteme
- Mensch-Maschine-Interaktion und ihre Modellierung
- Organisationsentwicklung
Paradigmen der Wirtschaftsinformatik
Paradigmen der WI
Ziele der Wirtschaftsinformatik: In der Praxis
- gesellschaftlich
- Steigerung Produktivität durch Automation
- für Volkswirtschaft wohlstandsmehrend wirken
- langrifristig (Utopie)
- ==Vollautomation betriebliches Geschehen==
- alle menschenähnlich durch IS bewältigbare Aufgaben, werden vom System übernommen (“sinnhafte Vollautomation”)
Betriebliche Informationssysteme
Klassifizierungen
- diverse Schemata für betriebliche Informationssysteme
- Einsatzgebiet
- Organisationsebene
- Anwendungsbreite/-form
- Spezifität
- Bereitstellungsform (on-premise vs. on-demand)
Organisationsebene
Transaktionssysteme
- elementare Leistungsprozesse des Unternehmens
- Standardisierung & Automatisierung ermöglichen effektive & effiziente Verarbeitung
- Prozesse mit hohem Datenvolumen
- Auswertung der Daten & Informationen für höhere Managmentstufen (vertikale Integration)
Ziel
- Vollautomatisierung von Aufgaben (Administrationssysteme) oder
- Teilautomatisierung zur Unterstützung menschlicher Mitarbeiter (Dispositionssysteme)
Managmentunterstützungssysteme
- Planungssysteme
- Unterstützung bei schlecht strukturierten Entscheidungsproblemen
- Kontrollsysteme
- Kontrolle der Einhaltung der Pläne ("Soll-Ist"-Vergleich)
- Hinweise auf Notwendigkeit von Korrekturmaßnahmen
==⇒ Zusammenfassender Begriff Business Intelligence==
Interaktionssysteme
- sind Querschnittssysteme
- Unterstützung Arbeitsgruppen ==auf allen Hierarchiestufen==
- auf und zwischen allen Organisationsebenen zur Zusammenarbeit verschiedener Aufgabenträger im Einsatz
- Arten
- IT-Kommunikationstools
- IT-Konferenztools
- Kollaborative IT-Managmenttools
Integration
- IS dienen nicht nur Unterstützung der Mitarbeiter bei Aufgabenerfüllung
- Informationssysteme verantworten auch Datenmanagment (einmalige Erfassung der Daten) ⇒ Fähigkeit der Integration
Definition Integration
Fähigkeit, Daten, Vorgänge und Sachen sachlogisch zu verzahnen
horizontal ↔️
- Verbindung unterschiedlicher Funktionsbereiche innerhalb eines Geschäftsprozesses auf gleicher Unternehmensebene
vertikal ↕️
- Verbindung operative Informationssysteme mit Planungs- und Kontrollsystemen
- Ziel: Datenversorgung zur Unterstützung des Managments
Ziel der Wirtschaftsinformatik hinsichtlich der Integration
- Geeignete Informationssysteme bereitstellen
Unternehmensübergreifende Informationssysteme
- zwischenbetrieblich vs. endkundenorientiert B2B vs. B2C
Hinweis zu präsentierten IS
ERP, CRM, SCM etc. sind nur in den Karteikarten eingepflegt
Übung
KLAUSURFRAGEN
- Nennen sie Beispiele für betriebliche Informationssysteme.
- Beschreiben sie die hierarchischen Unterschiede der unterschiedlichen betrieblichen Informationssysteme
- Nennen Sie die Integrationsarten von Informationssystemen.
- Was ist die vertikale Integration?
- Was ist die horizontale Integration?
Verständnisfragen
- Erläutern Sie, was die Wirtschaftsinformatik unter einem Informationssystem versteht.
- Nennen Sie die Arten unternehmensinterner Informationssysteme.
- Nennen Sie die Arten unternehmensübergreifender Informationssysteme.
- Erläutern Sie die Begriffe „horizontale Integration“ und „vertikale Integration“.
- Erläutern Sie die Bedeutung der Betriebswirtschaftslehre und der Informatik für die Wirtschaftsinformatik.
- Erläutern Sie, welche zwei Paradigmen der Wirtschaftsinformatik unterschieden werden können.
(Bächle/Daurer/Kolb, 2021)
Methoden der Wirtschaftsinformatik
IT-Projektmanagment
Projektmanagmentdefinition (DIN 69901)
Projekt
Vorhaben mit einmaligen Bedingungen (Zielvorgabe bzw. Begrenzungen)
Projektmanagment
Gesamtheit von Führung & Organisation für die verschiedenen Lebenszyklen eines Projekts
Lebenszyklus eines Projekts
Phasen werden mit Meilensteinen abgeschlossen (Ergebnisse müssen vorliegen)
Projektmanagmentprozess
- Unterteilung der Aktivitäten in Phasen
- Phasen sind nicht streng sequenziell
- wiederholt sich und wirkt in jeder Phase des Projektlebenszyklus
Projektmanagmentphasen (inkl. Beispiele)
-
Initialisierung Zuständigkeiten klären, Projektziele skizzieren
-
Definition Zieldefinition, Aufwandsschätzung & Machbarkeitsbewertung
-
Planung (Was soll wann, wie und durch wen gemacht werden) Termine & Arbeitspakete planen, Kostenplan, Risikoanalyse, Ressourcenplan
-
Steuerung (Überwachung und Soll-Ist-Vergleich) von Terminen, Ressourcen, Kosten, Risiken, Qualität, Ziele
-
Abschluss (Wurden die Ziele und Erwartungen erfüllt?) Erstellung Abschlussbericht, Nachkalkulation, Erfahrungssicherung, Vertragsbeendigung
Agiles Projektmanagment mit Scrum
Agiles Manifest
- Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge
- Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation
- Zusammenarbeit mit dem Kunden sind wichtiger als Vertragsverhandlungen
- Reaktionen auf Veränderung sind wichtiger als das Befolgen eines Plans
⇒ Rahmenwerk für leichtgewichtigen Managmentprozess
Rollen
- Team setzt Anforderungen aus Backlog um
- Product Owner Bindeglied zwischen Kunden/Markt und Entwicklerteam Beschreibung der Anforderungen und Aktualisierung des Backlogs
- Scrum Master Sicherstellung der Einhaltung der Scrum-Regeln
Meetings
- Sprint-Planungssitzung Start des Sprints
- Daily Was wurde erreicht? Was möchte ich erreichen? Hindernisse?
- Sprint Review Überprüfung und Abnahme des Inkrements
- Sprintretroperspektive Analyse von Zusammenarbeit und Prozess
Ergebnisse
- Backlog Alle Anforderungen
- Sprint Backlog im Sprint bearbeitete Anforderungen, priorisiert
- Produktinkrement unmittelbar nutzbares Ergebnis des Sprints
Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung
- Vorgehensmodell ==unterteilt den Entwicklungsprozess von Spftware in verschiedene zeitlich und inhaltlich abgegrenzte Phasen==
- Ziel: Komplexität beherrschen & Struktur schaffen
- Zur besseren Koordination erfolgt die Festlegung von
- Standards
- Methoden
- Schritte
- Teil- & Endziele
- Artefakte
- Die Artefakte einer Phase dienen als Ausgangsbasis für die Nächste
Vorgehensmodelle
Übung
Klausurfragen
Abgefragt wird abrufbares Wissen
- Was bedeutet Thema x?
- Nennen Sie Beispiele für xy.
Verständnisfragen
- Wie lassen sich Projekte klassifizieren?
- Welche Projektmanagmentphasen kennen Sie?
- Wie hängen Projektmanagmentphasen und Projektphasen zusammen?
- Welche Rollen kennt Scrum?
- Welche Werte unterscheiden “konventionelles” Projektmanagment von agilem Projektmanagment?
(Bächle/Daurer/Kolb, 2021)
- ab hier Karteikarten
Angebotsformen von Software
Standardsoftware
Standardsoftware
- nicht für einzelnen Kunden, sondern eine Kundengruppe mit ähnlichen Problemstellungen entwickelt
- Unterscheidung nach Komplexität der Produkte Basissoftware → Standardbürosoftware → Funktionsorientierte Software → Prozessorientierte Software
Unterscheidungskriterien
- Rechte an der Software
- Installationsort (bei Kunde oder von Anwender)
| Traditionelle Standardsoftware | Open Source |
|---|---|
| meist individuelle Konfiguration ⇒ geringere Diskrepanz zwischen betrieblichen Anforderungen und dem Funktionsumfang der Software | verteilter Entwicklungsprozess mit Entwicklern unterschiedlicher Unternehmen und Freiwilligen; öffentlich zugängiger Quellcode → Systeme können über Customizing hinaus auf Quellcodeebene unternehmensspezifisch angepasst werden |
| vielfältige Kriterien für Lizenzkosten | keine Lizenzkosten (oftmals jedoch kostenpflichtige Ergänzungsmodule) |
On-Premise & On-Demand
On-Premise
- direkt auf den unternehmenseigenen Servern und Infrastrukturen installiert und betrieben
- gesamte Infrastruktur, Wartung und Sicherheit liegt vollständig in der Verantwortung des Unternehmens selbst
On-Demand
- als Dienst über das Internet bereitgestellt wird (auch bekannt als SaaS - Software as a Service)
- Anwendung wird zentral gehostet und vom Anbieter gewartet
- Nutzer greifen über einen Webbrowser oder eine App darauf zu
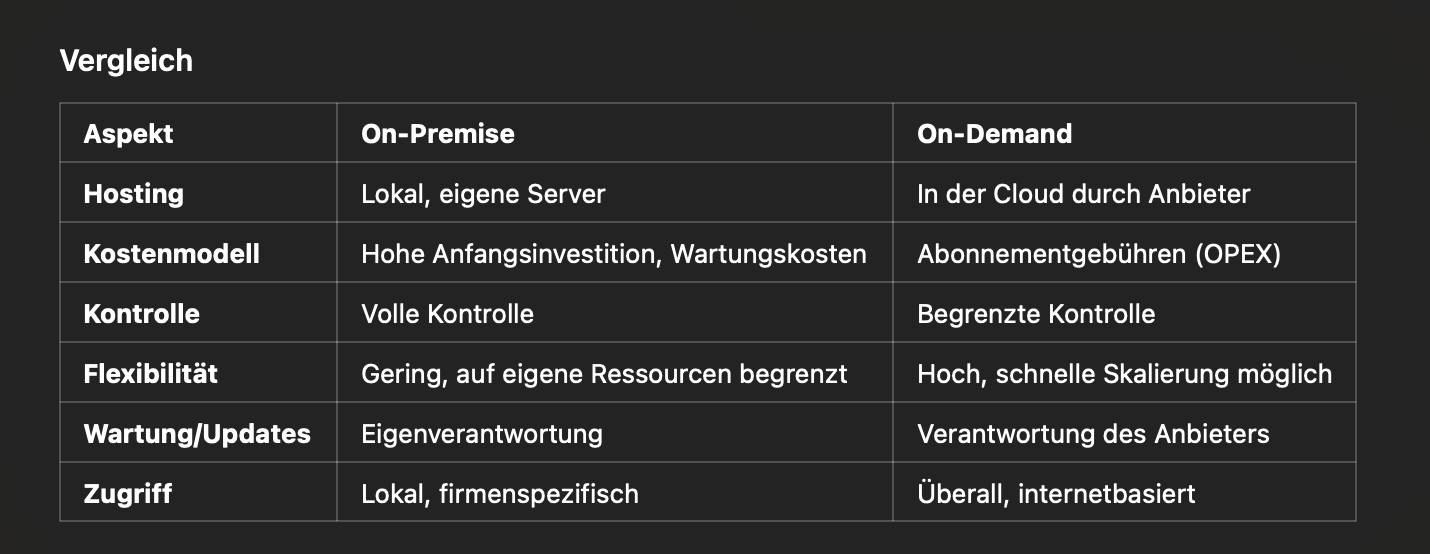
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Günstigere Anschaffungskosten | Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten |
| Schnelle Implementierung | Möglicherweise Überschuss an unnötigen Funktionen |
| Getestete und bewährte Lösung | Wenig Differenzierung von Mitbewerbern |
| Regelmäßige Updates | Risiko, nicht alle Geschäftsprozesse abzubilden |
| Standardisierte Prozesse | Eingeschränkte Unternehmens-Individualität |
Individualsoftware
Individualsoftware
Für spezielle betriebliche Anforderungen mit gegebener Hard- und Softwareumgebung individuell entwickelt (entweder selbst oder per Auftrag)
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Genau auf Unternehmensprozesse zugeschnitten | ==Höhere Entwicklungskosten== |
| Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit | Längere Entwicklungszeit |
| Keine Kompromisse bei Funktionalitäten | Risiken bei Implementierung |
| Wettbewerbsvorteil durch Unique Features | Aufwändige Wartung |
| Vollständige Kontrolle über Entwicklung | Abhängigkeit von Entwicklern |
Low-Code-Plattformen
Low-Code-Plattformen
- Softwareentwicklungsumgebungen mit visuellen Baussteinen
- Verwendung zur schnellen Entwicklung und einfachen Anpassung von Anpassungssystemen
Übung
Klausurfragen
Was sind die Vor- und Nachteile von Individual- und Standardsoftware
[Einführung & Entwicklung von Informationssystemen]
- Lastenheft & Pflichtenheft
[Digitalisierung und digitale Transformation]
Informationssysteme in der Wirtschaftsinformatik
Datenmodellierung
1. Konzeptionelle Datenmodellierung
- implementierungsunabhängig
- bildet Gegenstände der realen Welt & ihre Beziehungen untereinander ab
Entity-Relationship Model
Entity-Relationship Model in Entity-Relationship-Diagram (ERD)
- jede Entität wird mit Attributen beschrieben
- Attribute ==müssen einzigartige Identifizierung der Entitäten ermöglichen (ein Attribut ist Primärschlüssel (unique identifier))==
- Entitäten desselben Typs werden mit denselben Attributen beschrieben
- Relationships (Beziehungen)
- Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Entitäten
- beschreibbar mit Attributen
- implizieren Leserichtung
- Kardinalitäten
Komplexität des Beziehungstyps zwischen zwei Entities
quantitative Spezifikation für die Menge der auftretenden Beziehungen
Unterscheidung zwischen 1:1-, 1:n- und n:m-Beziehungen
Beispiel
2. Logisches Datenmodell
- Startpunkt: Art der Datenbank? ⇒ relationelles Datenmodell !
- Zielstellung: Überführung des konzeptionellen Datenmodells aus (1.) in ein auf die gewählte Datenbank zugeschnittenes ==logisches Datenmodell==
Relationenmodell
- Grundlage des Relationenmodells ist die ==Relation==
eine Relation ist eine Menge von Tupeln
Tupel in tabellenförmiger Darstellung (Tupel = Tabellenzeile)
Relation entspricht einem Entity-Typ, die Spalten entsprechen den Attributen
Beispiel
Klausurhinweis
Hinweise auf Kardinalität in logischem Datenmodell aus Texten herausfinden können.
Beispielaufgaben Modellierung
- Überführen Sie das ER-Modell vollständig in ein Relationenmodell:
Modellierungsaufgaben: https://deristvollfettdertrottl.wordpress.com/aufgabensammlung-von-er-diagrammen-2/
3. Physischer Datenbankentwurf
- Realisierung der logischen Datenmodelle erfolgt durch Datenbankmanagmentsysteme (DBMS)
DBMS
- effiziente und rechnergestützten Organisation, Speicherung, Manipulation, Integration und Verwaltung großer Datenmengen
- Funktionen
Speicherung, Überschreiben und Löschung (CRUD - Create, Read, Update, Delete)
Datenverwaltung auf Basis des Datenmodells
Datensicherheit, -schutz & -integrität
Mehrbenutzerbetrieb
effiziente Speichernutztung & optimierter Zugriff
Beispiele
MySQL, PostgreSQL, Oracle Database
Vorgehensweisen bei der Speicherung von Daten
| zentrale Datenbank | verteilte Datenbank |
|---|---|
| Daten werden an einem zentralen Ort bereitgestellt oder bearbeitet | Daten werden auf mehreren über Netzwerke verbundene physischen Orten gespeichert |
Verständinisfrage
- Erläutern Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen einem ER-Modell und einem relationalen Modell.
- Welche Funktionen erfüllt ein Datenbank-Managment-System?
Buchaufgaben Modellierung
Data Science
Begriffsdefinition Data Science
- interdisziplinäres Fachgebiet
- es werden relevante Informationen aus überwiegend komplexen Datenbeständen extrahiert → diese werden für datengetriebene Entscheidungsprozesse nutzbar gemacht
Managmentsunterstützungssysteme
Big Data
Big Data
- Big Data sind Datenbestände mit folgenden Merkmalen (4-V-Modell)
- Masse (Volume)
- Terra- bis Zettabyte
- Vielfalt (Variety)
- von unstruktrierten über semistrukturierten bis strukturierten Daten
- Geschwindigkeit (Velocity)
- Datenerfassung und -auswertung in Echtzeit
- Richtigkeit (Veracity)
- “hohe” Datenqualität ⇒ Nutzbarkeit für betriebliche Entscheidungen
Zur Auswertung werden typischerweise Data Science-Methoden Eingesetzt
Strukturierungsgrad von Daten
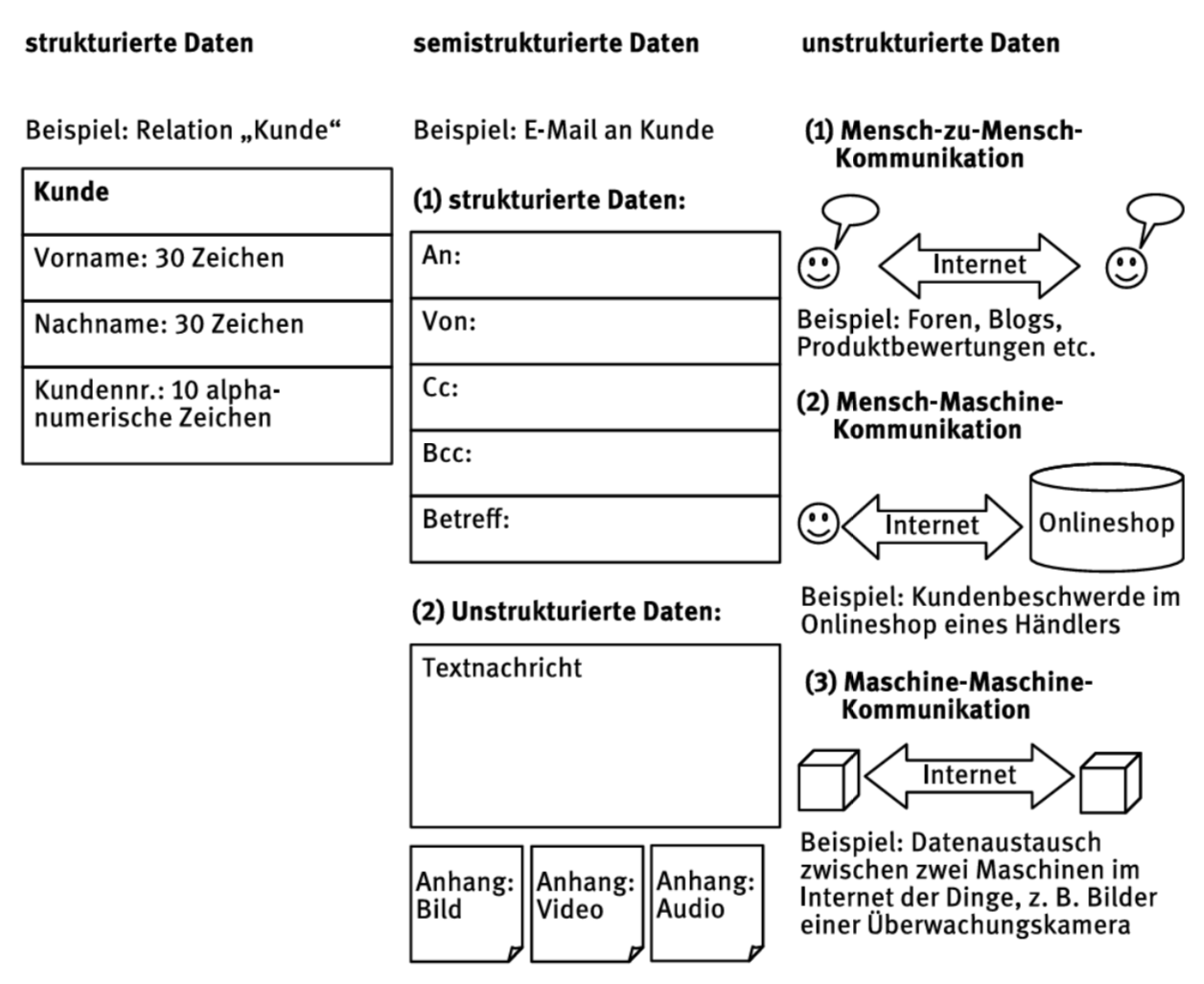
Wissensmanagment
Arten des Wissens
individuell & kollektiv
- individuell: Wissen eines einzelnen Mitarbeiters, jedoch nicht notwendigerweise der Gesamtorganisation
- kollektiv: steht in organisatorischen Einheiten (z.B. Teams) zur Verfügung und ist daher überindividuell
explizit & implizit
- explizit: formalisierbar (z.B. Verschriftlichung), kann gespeichert und weitergegeben werden
- implizit: nicht vollständig kodifizierbares Wissen ⇒ kann nicht zwischen Personen vermittelt werden
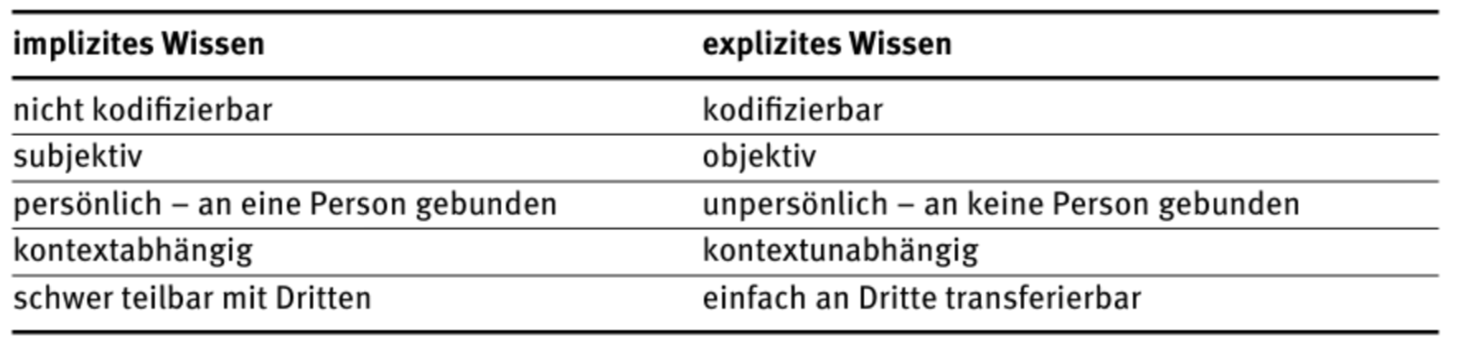
Beispiele: Wissensformen in Projekten
Kodifizierung von Wissen
- für Weitergabe muss Wissen kodifiziert werden (z.B. Dokumente mit Sprache)
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| zuvor lediglich implizites Wissen wird… allgemein zugänglich | Bestandteile impliziten Wissens gehen verloren (insb. Erfahrungen und mit Kontextwissen des Individuums verbundenes Wissen) |
| digital speicherbar | Darstellungsformen von Wissen sind ==fehleranfällig== |
| leichter weiterzugeben | |
| ==einfacher mit anderem Wissen kombinierbar== |
Probleme beim Wissensmanagment
- Neuerfindung des Rads
- Mitarbeiter verlassen das Unternehmen (z.B. Ruhestand)
- unzureichender Austausch von Wissen innerhalb von Unternehmen
- relevantes organisationales Wissen wird nicht angemessen strukturiert und dokumentiert
Ansätze & Arten des Wissensmanagment
- verhaltensorientierter Ansatz: Mensch als eigentlicher Wissensträger steht im Vordergrund
- technologischer Ansatz: technische Lösungen für das Wissensmanagment stehen im Vordergrund
Aufgaben des Wissensmanagments
Strategieebene
- ==Definition der Wissensziele==
- Zielbeitrag des Wissensmanagments für den strategischen Unternehmenserfolg muss laufend bewertet werden
Prozessebene
- Wissensidentifikation
- Welches Wissen haben wir, welches fehlt?
- Wissenserwerb
- Erschließung von Wissensquellen zur Schließung von Wissenslücken
- Wissensentwicklung
- Neues relevantes Wissen gezielt entwickeln
- Wissensverteilung
- Mitarbeitern Wissen zielgerichtet für Aufgabenerfüllung zur Verfügung stellen
- Wissensnutzung
- Mitarbeiter motivieren, Wissensquellen tatsächlich zu nutzen
- Wissensbewahrung
- Präventation unbeabsichtigten Wissensverlust
Anwendungsfelder der Wirtschaftsinformatik
Ansätze zur Ausgestaltung & Umsetzung des Informationsmanagments
Beschäftigungsfeld WI
Entwicklung und Anwendung von Informationssystemen für betriebliche Aufgabenstellungen
Informationsmanagment
Planung, Steuerung & Kontrolle von
- Informationen
- Informationssystemen
- Informations- & Kommunikationstechnik
Ausgestaltungs- und Umsetzungsansätze des Informationsmanagments
- prozessorientierte Konzepte
- Architektur- bzw. Referenzmodelle
- Problemorientierte und aufgebenorientierte Konzepte
Prozessorientierte Ansatz: Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
-
Modell: beschreibt, WAS gemacht werden muss, nicht WIE die Umsetzung konkret aussehen soll
-
Kernprozesse (ITIL 3):
- Sevice Strategy, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement
Merkhilfe
STOCsi Simples Thunfisch Orgien Continual-Service-Improvement
Architekturmodell: ARIS
⇒ Architektur integrierter Informationssysteme
ARIS-Haus (ARIS House of Business Engineering)
- fünf Beschreibungsschichten
- Organisation, Daten, Steuerung/Prozess, Funktion, Leistung
- Untergliederung der Beschreibungsschichten in drei Ebenen
- Fachkonzept → Datenverarbeitungskonzept → Implementierung
Aufgabenorientierter Ansatz nach Heinrich
- Aufgaben auf strategischer Ebene
- Planung, Überwachung & Steuerung der Informationsinfrastruktur als Ganzes
- Aufgaben auf administrativer Ebene
- Planung, Überwachung & Steuerung des Informationsinfrastrukturbestands ⇒ Ziel: produktiv verfügbare IT-Komponenten bereitstellen
- Aufgaben auf operativer Ebene
- Nutzung der Informationsinfrastruktur
Geschäftsmodelle
Definition Geschäftsmodell
Kompaktes Konzept zur Analyse verschiedener Aspekte einer Unternehmung
Hintergrund
zunehmende Digitalisierung sorgt für Innovationen, die weder klassischen Produkt- noch Prozessinnovationen entsprechen
Business Model Canvas
- Framework, um Elemente eines Geschäftsmodells strukturiert zusammenzufassen
- Einstiegsmöglichkeit für Erstellung Business Plan oder Analyse bestehender Geschäftsmodelle
Geschäftsprozessmodellierung
Definition Geschäftsprozess
Sachlogisch-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten/Aktivitäten/Vorgängen
Merkmale von Geschäftsprozessen
- durch Ereignis ausgelöst und beendet
- nicht an organisatorische Unternehmensgrenzen gebunden
- Ausführungsmöglichkeiten: nacheinander, wiederholt, parallel, alternativ
- Abbildung von standardisierbaren Routinetätigkeiten
- Unterteilung
- Managmentprozesse
- Geschäfts-/Kernprozesse
- Unterstützungsprozesse
Voraussetzung zur Abbildung von Geschäftsprozessen in IS
- Geschäftsprozessanalyse → Erfassung Ist-Zustand
- Geschäftsprozessoptimierung → Modellierung gewünschter Soll-Zustand
- ==In der Praxis sind keinen optimalen Geschäftsprozesse vorhanden, Modellierung kann jedoch zur Optimierung beitragen, bevor vor Abbildung in IS erfolgt==
Ermittlung der Anforderungen an Informationssystem
Wovon hängen die Anforderungen an ein Informationssystem ab?
- Geschätsmodell
- Unternehmensaufbau
- (Geschäfts)prozesse
Aufbau- & Ablauforganisation
siehe Zusammenafssung BWL